Cistus creticus L. (Graubehaarte Zistrose)
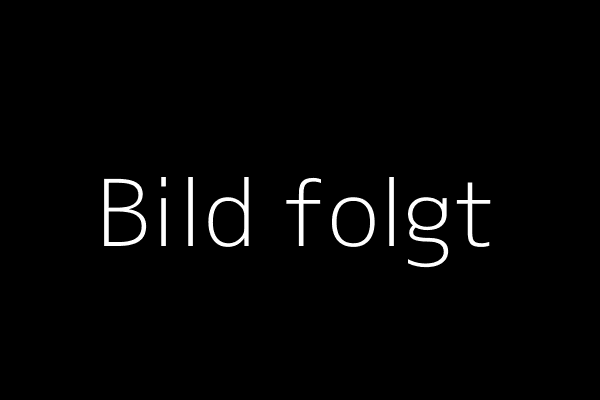
Nomenklatur & Systematik
- Familie
Cistaceae
- Gattung (botanisch) / Sektion
Cistus
- Artname (botanisch)
Cistus creticus L.
- Synonyme (botanisch)
Cistus incanus auct. non L., Cistus × incanus L., Cistus albidus L. x Cistus crispus L., Cistus × incanus ssp. creticus (L.) HEYWOOD, Cistus × incanus var. creticus (L.) BOISS., Cistus polymorphus f. creticus (L.) BATT., Cistus polymorphus var. creticus (L.) BALL, Cistus villosus L., Cistus villosus ssp. creticus (L.) NYMAN, Cistus villosus var. creticus (L.) BOISS., Cistus vulgaris SPACH, Cistus vulgaris var. creticus (L.) STEUD.
- Gattung (deutsch)
Zistrose
- Artname (deutsch)
Graubehaarte Zistrose
- Andere Artnamen & Volksnamen (international)
Cystus (ger.), Hoary rock-rose (engl.), Kretische Zistrose (ger.), Pink rock-rose (engl.)
Geobotanik & Ökologie
- Geographische Herkünfte (H) / Verbreitungen (V) / Anbaugebiete (A)
- ▪ H: Mittelmeergebiet (zentral bis v.a. östlich, seltener westlich) [4][24], Mittelmeergebiet (Kreta, Korsika, Sardinien, Italien) [1][24], Mittelmeergebiet (Sizilien, Zypern, Ostägäische Inseln) [1], Mittelmeergebiet (non Iberische Halbinsel) [24], Nordwestafrika (Marokko) [1][24], Vorderasien (Türkei, Türkei in Europa, Levante, Libanon-Syrien, Palästina) [1][24], Südosteuropa [24], Südosteuropa (Albanien, Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien) [1]
- ▪ V: westl. Nordamerika (Kalifornien) [1], Ozeanien (Neuseeland-Nord, Neuseeland-Süd) [1], Australien (Tasmanien) [1]; selten: Nordwestafrika (Algerien) [1], Nordafrika (Libyen) [1]
- Klimazonen
IV-Wechselfeuchte Subtropen (winterfeucht) [25]
- Biotoptypen
- -
- Standortbedingungen
- -
- Standortfaktoren (Ökofaktoren)
- Licht
- -
- Temperatur
- -
- Feuchtigkeit
- -
- Wind
- -
- pH-Klasse
- -
- Stickstoff
- -
- Salz
- -
- Soziol. Pflanzencharakteristik
- Lebensform
Zwergstrauch (holziger Strauch <0,5 m) [24]
- Blattausdauer
- -
- Messtischblattfrequenz Mitteleuropas
- -
- Dominanz
- -
- Erntezeit
- -
Pharmazie & Pharmakologie
- Giftigkeit / Risikopotential
- -
- Nebenwirkungen / Risikobemerkungen
- -
- Giftige / Allergene Pflanzenteile
- -
- Pharmakologische Studienergebnisse
- ▪ Die in den Blättern enthaltenen Polyphenole (Gerbstoffe wie Ellagitannine und Proanthocyanidine sowie Flavonoide) haben eine adstringierende Wirkung [24]
- ▪ In standardisierten Zistrosen-Extrakten wurden in vitro (in Zellkulturen) und in vivo (im Tierversuch) eine antivirale Wirkung nachgewiesen, darunter auch gegen verschiedene Influenzaerreger, wobei der antivirale Effekt durch eine – reversible – physikalische Interaktion des Extrakts mit Proteinen von Virusoberflächen zustande kommen soll [24]
- ▪ In 2016 am Helmholtz Zentrum München publizierte Forschungen zeigten, dass Extrakte aus Cistus creticus in vitro sogar lebensbedrohliche Viren wie das Ebolavirus inaktivieren und deren Vermehrung unterbinden können [24]
- ▪ Positive Erfahrungsberichte aus Selbsthilfegruppen von Borreliosepatienten über erhebliche Schmerzlinderung nach der Einnahme von Cistus-creticus-Blattzubereitungen regten Forscher am pharmazeutischen Institut der Universität Leipzig zu Untersuchungen an, die in vitro durch Extrakte aus Cistus creticus starke Wachstumshemmung bei Borrelien nachwiesen [24]
- ▪ Insgesamt ist die Droge aber weitestgehend noch unzureichend untersucht [4]
- ▪ Studien bis ins Jahr 2009 wiesen angeblich nur bei äußerlicher Anwendung eine Wirkung auf verschiedene Krankheitserreger nach, entweder in vitro oder im Pflanzenschutz. Von Kritikern wurde jedoch hervorgehoben, dass die dafür verantwortlichen Inhaltsstoffe, die polymeren Polyphenole, kaum bioverfügbar seien und daher eine therapeutische Anwendung bei Tier und Mensch lediglich – zum Beispiel mittels eines Aerosols – lokal wirksam sein könne, nicht aber bei peroraler Verabreichung systemisch, also für den gesamten Organismus. [24]
- Vergleiche zu ähnlichen Pflanzen
- ▪ Eventuell besteht in Cstus creticus ein höherer Polyphenol-Gehalt als im Grünen Tee oder Rotwein [4]
- ▪ Es besteht Verwirrung zwischen dem Namen "Cistus creticus" und einem früher von Linné veröffentlichten Namen, "Cistus incanus". So wird "Cistus creticus" häufig auch fälschlich als „Cistus incanus“ bezeichnet. Mit dem von Linné veröffentlichten Namen „Cistus incanus“ bezieht er sich aber auf Cistus creticus ssp. eriocephalus (ein Synonym von Cistus tauricus) [24]
- ▪ Die echte "Cistus × incanus" ist die Hybride aus Cistus albidus × Cistus crispus. [24]
- ▪ Bei Cistus creticus werden außerdem folgende Unterarten anerkannt: Cistus creticus ssp. creticus (zentrales und östliches Mittelmeergebiet) und Cistus creticus ssp. trabutii (Marokko) [24]
- Standortbesonderheiten (biochemisch / geoökochemisch)
- -
- Konservieren & Aufbewahren
- -
Medizin & Rezepturen
- Evidenzbasierte Medizin EbM / Monographien (Evidenzgrad I-IV)
- ▪ [+] EbM/Monographien:
- ►Immunsystem: immunstimulierend [4]
- ▪ [+] EbM/Monographien:
- Pharm. / labor. Studienergebnisse (Evidenzgrad V-VI)
- -
- Monographien (obsolet)
- -
- Traditionelle Volksmedizin
-
▪ [++] Volksmed.:
-
▪ [+] Volksmed.:
- ►Atemwege / Erkältung: Grippaler Infekt [25][95]
- ►Atemwege / HNO: Schleimhautentzündungen (Mund- und Rachenraum) [4], Halsschmerzen [25]
- ►Atemwege / Lunge: auswurffördernd [4]
- ►Haut: entzündungshemmend [95], Hautbeschwerden (Akne) [4], Hautkrankheiten [24], Neurodermitis [4], blutstillend [4]
- ►Infektion: Hauterkrankungen [4], antibakteriell [95], antiviral [25][95]
- ►Magen-Darm: Durchfall [24], adstringierend [24]
-
- Homöopathie
- -
- Anthroposophische Medizin
- -
- Kontraindikationen (Gegenanzeigen)
- -
- Wechselwirkungen
- -
- Darreichungsformen & Zubereitungen
- ▪ [Volksmed.]:
- Arzneimittel & Fertigpräparate (Beispiele)
- Medizinische Rezepturen
- ▪ [Tee bei grippalen Infekten]: 30 g getrocknetes Zistrosenkraut, Anissamen und Süßholzwurzel vermischen. 1 EL davon mit 250 ml heißem Wasser übergießen und 10 Minuten abgedeckt ziehen lassen, anschließend abseihen. 3-4mal täglich eine Tasse davon trinken, nach Geschmack mit Honig süßen [97] (2/2023)
- ▪ [Immunstärkender Tee - antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend]: Zutaten: 3 EL Zistrosenkraut, 3 EL Salbeiblätter, 2 EL Thymiankraut, 2 EL getrocknete Ingwerwurzelstückchen, 2 EL grüner Tee; Zubereitung: Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut durchmischen. 1 TL der Mischung mit 250 ml kochendem Wasser überbrühen und abgedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb abseihen [95] (2/2024)
- Rezepte - Essen & Trinken
- -
Nutzpflanzenkunde & Ethnobotanik
- Nutzung nichtmedizinisch (obsolet)
- ▪ [Lebensmittelpflanze]: Auch für die Antike ist die Verwendung – neben den medizinalen Anwendungen – als Gebrauchstee nachgewiesen [24]
- Ethnobotanische Bedeutung
- -
- Ethnobotanische Bedeutung (obsolet)
- -
Quellenangaben
- [1] Royal Botanic Gardens (Kew) (ff): Plants of the World Online; https://powo.science.kew.org/
- [4] Schönfelder I. & Schönfelder P. (2011): Das neue Handbuch der Heilpflanzen; Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart
- [24] Wikipedia (ff): Die freie Enzyklopädie / The Free Encyclopedia; https://www.wikipedia.org/
- [25] Busse B. (ff): Eigene Darstellung; PlantaMedia
- [95] LandAPOTHEKE (ff): Heilen und Pflegen nach alter Tradition; FUNKE Lifestyle GmbH
- [97] Natur & Heilen (ff): Die Monatszeitschrift für gesundes Leben; Natur & Heilen GmbH & Co. KG
- Autoren
- Letzte Änderung
14.04.2025